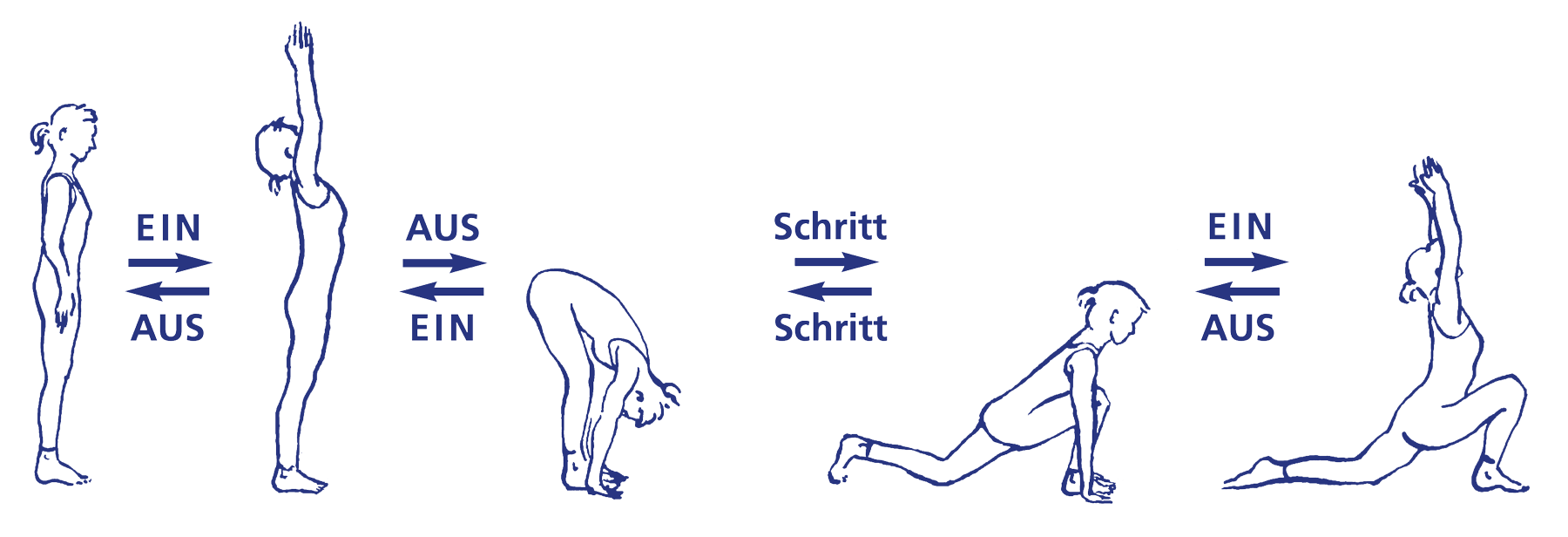Yogapraxis
Üben, Lernen und Unterrichten
Diese Artikelreihe widmet sich ganz der Yogapraxis.
Egal, ob du mehr über Meditation oder Prāṇāyāma erfahren möchtest, fundierte Informationen zu einzelnen Āsana suchst oder dich für bestimmte Zielgruppen interessierst – hier wirst du fündig!
Yoga & Gesundheit
Medizin, Wissenschaft und Krankheitsbilder
Die hier versammelten Artikel beleuchten Yoga aus medizinischer und wissenschaftlicher Sicht.
Dazu gehören Beiträge zu Themen, wie Yoga wirkt, einzelnen Körperregionen, Artikel zu Yoga als Therapie und vielen Krankheitsbildern im Kontext Yoga.
Tradition
Yoga im Wandel
Äußere Veränderungen waren schon immer eine wichtige Voraussetzung für die Weiterentwicklung des Yogas.
Unter der Überschrift Tradition – Yoga im Wandel findest du daher nicht nur Artikel zu Hintergrund, Geschichte und wichtigen traditionellen Texten und Schriften, sondern auch Beiträge, die sich unter dem Stichwort Travelling Yoga mit Veränderungen und notwendigen Anpassungen im Yoga auseinandersetzen.
Yogapraxis
Yoga &
Gesundheit



Über Viveka |
Kontakt |
Newsletter
FAQ |
Impressum |
Datenschutz
AGB |
Cookies